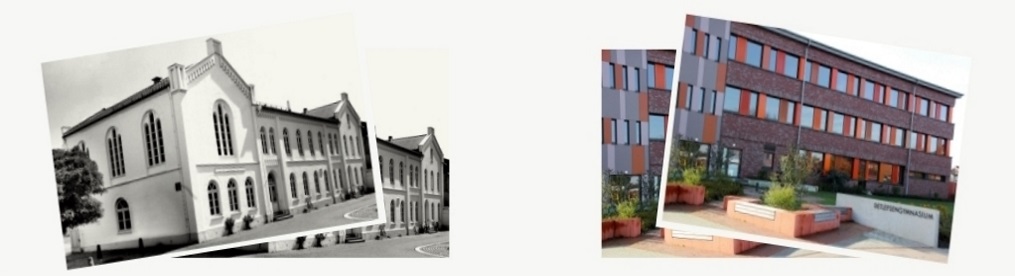„Was wir können, das ruft uns dazu auf, es auch zu tun.“ So beginnt ein kleiner Aufsatz überschrieben „Willensbildung“, der mir im August in die Hände fiel, als ich mal wieder grübelte, worüber ich reden könnte.
Haufen von Zeitungsausschnitten und Stichworten hatten sich schon angesammelt. Doch immer die Mahnung im Kopf „Du musst daraus keine Doktorarbeit machen!“ und „Red‘, wovon du was verstehst!“, hatte ich Trump, Terrorismus, Hackerangriffe und einiges mehr verworfen. Was mit Schule, mit meinen Erfahrungen mit Schule sollte es sein.
Als ich in dem Aufsatz weiterlas, wusste ich, das ist mein Thema: „Was wir können, das ruft uns dazu auf, es auch zu tun. (…)
Was dabei allerdings oftmals in Vergessenheit gerät, ist die Frage, ob ich das, was ich kann, eigentlich auch will.“ (Philip Kovce, Willensbildung, Eine Übung, in: DAS GOETHEANUM Nr. 32-33, 04. August 2017) Die Ulla war nämlich eine, die viel konnte und dafür viel Lob – und gute Zensuren einheimste. Was ich konnte, reichte, um gut durchzukommen. Da musste ich nicht fragen, was ich vielleicht wirklich wollte.
Und das hatte Folgen: „Wer nur tut, was er kann, der (…) folgt anstatt dem Wollen dem Können. Folge: Er lernt nicht, das zu können, was er will. Folge: (…) Könnerschaft ohne Willenskraft ist hohl.“ (ebenda).
Im Leben musste ich lernen, hohle Könnerschaft in echte zu verwandeln. Und das führte durch manche Tiefen, aber ich durfte wenn auch spät und vereinzelt auch erleben, wie es beflügelt, wenn der Wille entzündet ist „und den entsprechenden Fähigkeiten entgegenträgt. Wer tut, was er will, und nicht nur tut, was er kann, der verwandelt die Welt.“ (ebenda) Das sollte meines Erachtens Ziel von Erziehung sein: Willen zu wecken und zu befähigen, Willen zu entwickeln und daraus dann Könnerschaft. Wie das geschehen kann und ob Schule mir davon etwas gegeben hatte, das wollte ich näher ansehen. Als ich so weit war, erbat ich mir von unserem Sprecher Norbert den Text der Rede, die ich 1986 als Ehemalige vor den Abiturienten gehalten hatte. Verblüfft stellte ich fest, wie ähnlich meine Gedanken schon da gewesen waren, wenn auch in anderen Worten und mit anderer zeitgeschichtlichen Einbettung. Auch hinter der Abi-Rede von 1965 lag letztlich diese Frage. Nun steh ich hier vor euch und halt´ zum dritten Mal eine Rede und eins sage ich euch: Es ist die letzte!
In der Rede als Sprecherin der Abiturienten 1965 konnte ich, schon angeweht vom Geist der 68er, in meiner Erziehung an der Schule nichts Förderliches entdecken. Ich sprach der Schule ab, uns ein „Zeugnis der Reife“ ausstellen zu können, da die Lehrer uns gar nicht kennen würden. Sie könnten nur unsere Leistungen benoten, so in etwa. Den Text gibt es nicht mehr, er wurde nicht im Primanerbericht abgedruckt. Nach der Rede stürzte der damalige Direx mit hochrotem Gesicht nach vorn und entschuldigte sich bei den anwesenden Lehrern und Eltern.
Als die Schülerzeitung – Michael Kerber sprach mich an – den Text von mir erbat, konnte ich ihn, im Umbruch in mein neues Leben nach der Schule, nicht finden. Er tauchte auch nicht mehr auf. In meinen heutigen Worten würde ich ihn so zusammenfassen: Mein Können ist gefördert worden. Ich hab viel Futter bekommen, aber satt bin ich nicht geworden. Das drückte ich dem Zeitgeist und meinem jugendlichen Alter von gerade 19 Jahren entsprechend in zugespitzter, durchaus gnadenloser Kritik aus. Allerdings richtig falsch war sie ja nicht.
1986 war das Jahr von Tschernobyl, am 26. April war es erst geschehen, und alle Reden kreisten um diesen Schrecken. Ich, inzwischen Mutter von zwei kleinen Kindern, wendete ihn zu Appellen an die Abiturienten und die Lehrer, wie solch einem zerstörerischen Denken entsprungener Wahnsinn mit einer anderen Haltung sich selbst, dem Leben und dem Anderen gegenüber verhindert werden könnte. Also Appelle, Idealvorstellungen. Ich schätze, auch damit lag ich im Trend dieser neuen Zeit.
Für diese Rede heute habe ich genau hingeschaut auf viele kleine feine Erlebnisse, die das Schulleben so prägen. Wie war Schule für mich, was hat mich unterstützt, was gebremst? Einige davon will ich jetzt zum Schluss erzählen:
Lehrer Broders war mein Lehrer auf der Grundschule. Seine Begeisterung für die Halligen – er war vorher dort Lehrer gewesen – ließ mich begeistert die Zisternen zum Regenwasser Auffangen Backstein für Backstein zeichnen, seine Technikfreude ebenso die Brücken über den Nord-Ostsee-Kanal, jede einzelne mit ihren verschiedenen Bögen. Und weil er sich von uns jedes Jahr zum Geburtstag sein Lieblingslied wünschte, schmetterte ich hingebungsvoll „Hoch auf dem gelben Wa-ha-gen…“, alle Strophen. Überhaupt sangen wir gern und viel.
Die Freude am Singen wurde mir auf der Oberschule – so hieß unsere Schule damals, noch nicht Gymnasium – ausgetrieben durch einen Musiklehrer, der mir das Vorsingen erließ, weil ich das einfach nicht könne. Man könne singen oder man könne es eben nicht. Basta. Er werde meine Leistungen nur in Musiktheorie bewerten, wo ich – natürlich – gute Zensuren erhielt. Der tapfere Einwand meines Mitschülers Norbert, er habe aber gelesen, dass jeder Mensch singen könne, wurde unwirsch weggewischt. Viele Jahre wagte ich nicht zu singen, noch bei den Gutenachtliedern für die Kinder versagte mir die Stimme, wenn ein anderer Erwachsener den Raum betrat. Die Sehnsucht blieb, wenn schon nicht zu können, so doch lernen zu können, und heute teilen ja einige die damals ganz neue Erkenntnis. Und ich mache seit vielen Jahren mindestens einmal im Jahr einen Kurs, in dem ich das ausprobiere.
Fräulein Ipland entdeckte, dass ich ständig Geschichten schrieb, und ermunterte mich sie vorzulesen, einmal die Woche in ihrem Deutschunterrricht, so die letzte Viertelstunde, glaub ich. Die anderen fanden das natürlich gut und hörten gern zu. Ipland lobte mich nicht groß, dass ich den Raum kriegte, war Anerkennung genug.
Die nächste Deutschlehrerin nahm mich nach der Rückgabe eines Aufsatzes beiseite, ob meine Eltern mir schon Thomas Mann zu lesen gäben. Ich stotterte irgendwas, hatte von Thomas Mann noch nie gehört, ob meine Eltern mir Bücher von ihm hätten geben dürfen oder vielleicht sogar hätten sollen oder ob sie in ihrer Bertelsmann Auswahl überhaupt ein Buch von ihm hatten, wusste ich alles nicht, wollte die Eltern auch nicht verraten. Meine sichtliche Konfusion führte zu der Erklärung, ich hätte so einen unglaublichen Wortschatz, woher das nur käme? Ich läse eben viel, brachte ich heraus, Karl May, fiel mir ein, sagte ich aber nicht. Solch Lob verwirrte mich zutiefst, die hatte keine Ahnung von mir.
Noch zwei Namen möchte ich nennen, Sophus Elend und Chef Baumgärtner. Sophus sorgte ohne Aufhebens dafür, dass ich, wohl ab Untersekunda – es war bei uns zu Hause mit inzwischen drei Kindern an der Oberschule sehr knapp und irgendwie hatte er davon erfahren – ein Taschengeld aus welcher Quelle auch immer bekam, 40 Mark im Monat! Gegen Ende der Schulzeit schlug er mich für die Studienstiftung des Deutschen Volkes vor, was wohl mit ziemlich viel Aufwand verbunden war, denn Stipendiaten aus Schulvorschlägen gab es nicht viele. Es klappte dann. Und erleichterte meinen Eltern, uns alle drei studieren zu lassen. Von Sophus noch was ganz anderes: Er hat auf unserer Klassenfahrt in die Alpen auf dem Markt in Bozen die frischen Feigen, von denen er tagelang geschwärmt hatte, nicht nur gekauft, sondern alle aufgegessen. Am nächsten Tag betreute uns seine Frau allein. Mir ist seine Begeisterung im Sinn geblieben, nicht seine Unvernunft.
Ja und Chef Baumgärtner, wir hatten ihn nicht im Unterricht, nur einmal in einer Vertretungsstunde. Er schrieb ellenlange Ableitungen an die Tafel, um uns zu beschäftigen. Mir fiel eine Abkürzung ein, was ihn erstaunte. Ob wir das Thema schon gehabt hätten? Nein, hatten wir nicht. Ohne weitere Worte ließ er mich den anderen den von mir gefundenen Weg erklären. Das reichte auch, die Stunde zu füllen. Dass er meine Entdeckung gut fand, merkte ich, aber er machte nicht groß was her. Das tat gut, Anerkennung, aber ohne Scheinwerfer. Später übertrug er mir die Aufgabe, Spiele und Geschenke für ein Fest mit einer Berliner Gastklasse zu organisieren. Ich scheiterte völlig! Die Großstadtgören waren an meiner provinziellen Animation nicht die Bohne interessiert. Er merkte, dass ich es nicht hinkriegte, und übernahm unauffällig und ohne Vorwürfe und rettete die Situation. In der Nachbesprechung mit mir meinte er nur, er hätte es mir zugetraut, aber da müsse ich noch was lernen. Da fühlte ich mich in einer Schwäche erkannt und in richtiger Weise unterstützt. Bei ihm hätte ich was lernen können, aber er verließ bald die Schule.
Eigener Enthusiasmus des Unterrichtenden weckt den Willen, der den Fähigkeiten, dem Können entgegenträgt. Und liebevolle Unterstützung gibt das Umfeld, in dem sie wachsen können. Begebenheiten aus meiner Schulzeit habe ich so neu ordnen können.
Um wenigstens einen kleinen Eindruck von der heutigen Schule zu bekommen, bin ich im Sommer zu einer Aufführung von „Alles gut!“ gegangen, einem musikalischen Theaterstück nach Voltaires Candide, an dem die Musik-Theater-Arbeitsgemeinsch
Da gäbe es noch Vieles und Viele, aber ich will den Ratschlag einer Hamburger Freundin beherzigen: Du kannst über alles reden, nur nicht über zwanzig Minuten. Danke.